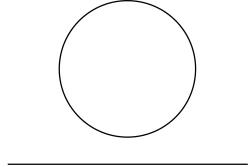Scelsi, Ustwolskaya und Leif
Beim Durchforsten der unendlichen Archive stellt man fest: (E-)Musik, abgesehen vom mehr oder weniger bekannten Kanon der großen Meister, ist selten wirklich gut. Eher ist sie kraftlos, abgeschmackt und stereotyp (wofür sich aber freilich stets irgendein Kommentator findet, der sie jeweils als »das Wunderbarste was sich auf ganz Youtube findet« etc. bezeichnet). Was mich anlangt, so finde ich drei KomponistInnen des letzten Jahrhunderts besonders reizend, trotzdem sie einigermaßen unbekannt sind.
Giacinto Scelsi (1905-1988) war ein italienischer Graf und in seiner ersten Lebenshälfte ein künstlerischer Mann von Welt, er hat in Wien Komposition studiert, verkehrte mit Avantgardekünstlern wie Dali oder Michaux und unternahm auch Reisen nach Afrika und in den Fernen Osten (was für sein späteres Schaffen von Bedeutung sein sollte). Unzufrieden damit, dass er seiner Meinung nach trotz seiner jahrelangen Bemühungen noch nicht zu einem wahren künstlerischen Ausdruck vorgestoßen sei, fiel er schließlich, im Zusammenhang mit seiner Scheidung, in eine existenzielle Krise und kam in eine psychiatrische Anstalt, wo er, laut Legende, den Tag damit zubrachte, am Klavier einen einzigen Ton anzuschlagen, was ihm schließlich zum Durchbruch verhalf. Nach seiner Genesung im Alter von fünfzig Jahren beginnt seine »eigentliche« Schaffensphase, wobei seine Werke Zwitter aus Kompositionen und Improvisationen sind. An der Aufführung seiner Werke war er nicht dringend interessiert und just als er zum höchsten künstlerischen Ausdruck, der wahren Subjektivität, vorgestoßen ist, lässt er keine Fotos mehr von sich zirkulieren und ersetzt seine Unterschrift durch einen Kreis mit einer Linie darunter (einem östlichen Symbol), dem gemäß, dass er sich weniger als ein Künstler denn als ein Medium sieht, das die Klänge einer höheren, transzendenten Realität vermittelt (und tatsächlich ist Scelsi zum wahrhaft höchsten Ausdruck der objektivierten, objektiv gültigen Subjektivität vorgedrungen). Offenheit zu verwirklichen und Transformation zu ermöglichen sei sein eigentliches Ziel gewesen. Erst in den 1980er Jahren wird sein Schaffen einem breiteren Publikum bekannt, und es wird offensichtlich, dass Scelsi die Geheimnisse der mikrotonalen Musik bereits vor Ligeti auszuloten begonnen hat.
In den zumeist über mikrotonale Veränderungen errichteten Kompositionen und in ihrer schönsten Erscheinungsform in den Orchesterwerken wie Aion, Quattro Pezzi, Pfhat, Hymnos oder Anahit scheint man tatsächlich den Klang des Universums zu haben, des Om, der Sphären, wie auch die Ambiguität des Universums als gleichzeitig voll und leer, als Heimat wie als Ort der Unbeheimatetheit. Die vollständige Person nimmt diese Ambiguitäten in sich auf und transzendiert sie und erreicht so wahre Universalität, so scheint die Aussage. Der Philosoph Vladimir Jankélévitch, dessen Schlüsselwerk Die Musik und das Unaussprechliche erst vor Kurzem erstmals auf Deutsch erschienen ist (Eingeweihten galt sie als wichtigste französische musikphilosophische Schrift des 20. Jahrhunderts) spricht auch von der Idee bzw. der transzendentalen Kategorie der Ur- oder Sphärenmusik, die durch jedwede Komposition nicht erreicht werden kann: »Die Flöte, die den ‚göttlichen und heiteren künstlichen Atem‘ kanalisiert, um ihn erklingen zu lassen, beschränkt im Grunde die unendliche Musik«, so wie auch Scelsi den Ton als das Primäre und Zeitlose begreift, die kompositorische »Verbindung von Noten« als das Ephemere.
»Es gibt keine Verbindung zwischen meiner Musik und der eines anderen Komponisten, sei er lebend oder tot« – tatsächlich wird man als uneingeweihter Hörer von der grausam anmutenden Musik der Galina Ustwolskaya (1919-2006), die in ihrer scheinbaren Fragmentiertheit und Monotonie selbst gegenüber dem, was man gemeinhin unter »avantgardistischer Kakophonie« kennt und vermuten würde, in einem ganz anderen, jenseitigen und isolierten Bezirk angesiedelt zu sein scheint, bei den ersten Konfrontationen recht konsterniert sein. Gleichzeitig wird man, hoffentlich, Bewunderung für jemand empfinden, der sich in so idiosynkratischer, unerwarteter Weise über jegliche Hörgewohnheiten hinwegsetzt und die urtümliche, authentische Originalität dieser künstlerischen Stimme erkennen. Nach einer Weile, und einigen Anläufen, erschließt sich dann auch die Schönheit der Musik der Ustwolskaya.
Auch über Galina Ustwolskaya ist relativ wenig bekannt, sie hat es vorgezogen, recht privat zu leben und gebeten, von einer Interpretation ihrer Werke Abstand zu nehmen, als diese gegen Ende ihres Lebens international bekannter wurden (trotzdem es von etlichen ihrer Werke keine Tonträger gibt, man muss sich über Mitschnitte von Aufführungen im Internet helfen). Bekannt ist, dass die hochtalentierte Ustwolskaya eine Lieblingsschülerin Schostakowitschs gewesen war, weniger bekannt, dass es zwischen ihr und Schostakowitsch zu einem Zerwürfnis gekommen sein muss, als Resultat eines Zusammenpralls zweier machtvoller künstlerischer Persönlichkeiten. Wahrscheinlich war es der Drang, dem übermächtigen Einfluss ihres Lehrers zu entkommen, der Ustwolskaya schließlich, und nach erheblicher zeitlicher Verzögerung, in gänzlich andere und eigenständige künstlerische Bezirke geführt hat.
Dass Ustwolskayas Musik natürlich in einem gewissen Zusammenhang mit (russischen) musikalischen Traditionen steht, ist im Rahmen von Expertendiskussionen freilich vermerkt worden, vor allen Dingen ist es aber der (meta-)paradoxe Charakter ihres Werks, in dem die Genialität der Ustwolskaya ihren Ausdruck findet. In ihren Werken findet sich kaum Bewegung und Entwicklung, scheinbar als Widerhall auf Jankélévitchs Bemerkung, dass eine Komposition zwar die Sphären errichten will und Katharsis verdeutlichen, gleichzeitig aber nach einer Weile wieder verklingt und verschwindet, insistiert sie offenbar auf das Ergreifen des Moments (von dem die Weisen sagen, dass in ihm die Ewigkeit liegt, wenngleich bei Ustwolskaya diese Ewigkeit rätselhaft wird). Dass es keine Katharsis in ihren Kompositionen gibt, keine Erlösung, wie allgemein vermerkt wird, ist zwar nicht richtig, es handelt sich aber um eine enigmatische Katharsis. Ihre Sinfonien sind Gebete eines Menschen in einer Trümmerlandschaft, wobei es unklar ist, ob der Mensch oder Gott für die Trümmerlandschaft verantwortlich ist. (Sie stehen aber auf jedem Fall in einem Widerspruch zur offiziellen Sowjetideologie.)
Ustwolskaya selbst hat vermerkt, dass ihre Musik zwar nicht religiös, aber spirituell und geistig sei. Bereits Stravinsky hat gewusst, dass das Empfinden davon, was schön und gefällig sei, wandel- und erweiterbar ist und tatsächlich haben seine zunächst als fragmentierte Kakophonie wahrgenommen Kompositionen unsere Wahrnehmung dessen, was schön und wohllautend ist, erweitert. Wenngleich Ustwolskaya ein härterer Brocken ist, scheint der Fall bei ihr aber ähnlich. Nein, keine Sphären werden im Rahmen ihrer Sinfonien errichtet und es gibt keine Katharsis, nach einer Weile scheint das Hirn aber die Bausteine innerhalb der Trümmerlandschaft eigenständig zusammenzusetzen und die spirituell-intellektuell-ideellen Klänge, die man hört, werden glorreicher und intensiver als die von z.B. Beethovens Neunter. Ein Appell, nicht an die Brüder, sondern an den Einzelnen scheint auszugehen, inmitten einer Trümmerlandschaft authentische Moral und Konstruktivität zu verwirklichen.
»Mein erstes und letztes Ziel in meinem gesamten musikalischen Schaffen ist, ich selbst zu sein, ehrlich und echt zu sein, keinen fremden Einfluss von anderen hereinzulassen, keine Manieriertheit, keinen letzten Ausweg hinsichtlich des Könnens und des Stils…« – der Preis, den Jon Leifs (1899-1968) dafür bezahlte, war zeit seines Lebens weitgehend unverstanden zu bleiben. Wie bei authentischen Künstlern üblich, nahm auch Leifs in seinem Bestreben, seinem heimatlichen Island eine musikalische Identität zu geben, Vorhandenes und Lokales/Nationales, um es zu Zeitlosem, Allgemeinem und Ewigem zu transzendieren. Angehörige von Minderheiten bzw. Minoritäre im deleuzianischen Sinn scheinen hier in einer privilegierten Position, Neues zu schaffen und aus ihrer minoritären Position heraus einen unerwarteten Blickwinkel auf das Allgemeine richten zu können; als Isländer hatte Leifs aber wohl unter anderem das Pech, dass seine Position doch recht peripher war. Seine Werke überforderten isländische Orchester und Chöre aufgrund ihrer Neuheit und sein Hauptwerk, das Edda-Oratorium ist bis heute in seiner Gänze unaufgeführt, da es internationale Chöre sprachlich überfordert. Seine Orchesterwerke wurden erst nach seinem Tod allgemein aufgeführt. Innerhalb ihrer bildet Geysir wohl das Schlüsselwerk, in dem Leifs´ spezifische Originalität am besten und konzisesten zum Ausdruck kommt. Wenn man will, sieht man vor seinem inneren Auge schöne geometrische Muster aus rechten Winkeln, die sich in ihrem eigenen Saum widerspiegeln; nüchterner betrachtet, scheint man das tektonische Aufeinander- und Gegeneinanderwirken von Naturkräften, das sich schließlich in einem Ausbruch entlädt und dann wieder in die Stille hinabsinkt, zu hören bzw. das Erlebnis einer durch und durch idiosynkratischen musikalischen Sprache. Eine gleichzeitig so naheliegende, wie der herkömmlichen avantgardistischen musikalischen Sprache fernliegende Vertonung, ganz und gar unabgeschmackt, kann man tatsächlich nur von einer singulären Künstlerpersönlichkeit erwarten, die genau weiß, was sie tut und die eine umfassende Bekanntschaft mit den Dingen gemacht hat. Hekla ist die Vertonung eines Vulkanausbruchs und gilt als »lautestes Orchesterwerk aller Zeiten«. Leifs‘ Streichquartette sind auf eigentümliche Art gleichzeitig ruhig wie ereignisreich, spannend, dabei aber nicht auf nervige Weise aufgekratzt, wie man es sonst allgemein erwarten kann. In seinem letzten Werk, Consolation, scheint noch einmal die ewige Bewegung der Natur selbst zum Ausdruck zu kommen, und das Individuum als Teil dieser ewigen Bewegung. Die Aufgabe von Kunst sei es, Trost zu spenden, so Leifs‘ Credo.
Mein bevorzugter Klassikplattenhändler, Gramola am Graben, berichtet mir, dass er wenig von Scelsi, Leifs oder Ustwolskaya lagernd hat, da gerade alle paar Jahre einmal einer unter den KundInnen daherkommen und danach fragen würde. Nach was die Leute denn sonst verlangen würden, frage ich darauf ihn. »Kommerz«, sagt er. Man würde vermuten, dass die objektiv gewordenen Subjekte als die höchsten Instanzen des künstlerischen und menschlichen Ausdrucks die sind, die alles zusammenhalten, das ganze menschliche Band, sie stiften schließlich den Zusammenhang, und im Fall von z.B. Beethoven oder so, scheint das ja so zu sein. Zeit seines Lebens war Beethoven freilich einsam und genauso gut kann man die objektivierten Subjekte wohl als ewige Fremde in einer unzusammenhängenden, indifferenten Welt sehen. Diese Paradoxie muss man erst mal aushalten.